Der Skandal des Scheiterns

Computerspiele sind Experimentierfelder zum Austesten der eigenen Unzulänglichkeiten. Niederlagen tun weh, doch das macht uns nur stärker. Wer sich durchs Spielen dem eigenen Scheitern aussetzt, lernt nicht nur würdevolleres Verlieren, sondern auch einen besseren Umgang mit negativen Emotionen.
“Blood splattering onto the screen because I've been shot. OK, I've been shot. You don't have to penalise me further by reducing my vision. I feel bad enough already that I've been shot.” (James Leach, EDGE #251, Seite 138)
Es ist wie die Darstellung von Gewalt und jene von Schmerz und Leid. Gewalt ohne ihre negativen Auswirkungen zu zeigen, kann sie in manipulativer Weise verharmlosen, aber ihr auch ihre bedrohliche Aura nehmen, sie dekonstruieren, damit wir nicht mehr länger davor zurückscheuen, uns mit ihr auseinanderzusetzen. Im Spiel scheitern zu dürfen, ohne bestraft oder lächerlich gemacht zu werden, nimmt uns die Angst, dass wir es beim nächsten Anlauf eventuell noch mal falsch machen. Lange Ladezeiten, provokante Bildschirmmeldungen („You failed!“) oder sich penetrant wiederholende Todessequenzen: All das unterstreicht unsere schlechten Leistungen im Spiel noch zusätzlich. Dabei schämen wir uns doch ohnehin schon, wenn wir nach mehrfachem Anlauf mal etwas wieder und wieder nicht geschafft haben.

Spätberufene, die sich nach langen Jahren des Nicht-Auseinandersetzens mit Computer- und Videospielen dann doch dazu entschließen, sich ihnen zu widmen, haben kein einfaches Los. Ihnen ist das Wesen von digitalen Spielen oft noch völlig fremd, und das besagt eben vor allem: regelmäßiges Scheitern, um zu lernen, um voranzukommen. Der schmale Grat zwischen Überforderung und Langeweile ist der Schlüssel von gutem Gamedesign, von gelungenen Herausforderungen. Niemand, der Videospiele schätzt, will in ihnen auf Anhieb alle Hindernisse überwinden können, alle Gegner bei der ersten Konfrontation besiegen, sofort alle Rätsel durchschauen. Erfolge im Spiel wollen erarbeitet werden, mit konzentrierter Beschäftigung und dem Willen, aus den eigenen Fehlern zu lernen. Gerne hört man bekennende Gamer den motivierten Newbies zurufen: Lasst es lieber bleiben. Es tut weh.
Spiele sind ein wunderbares Experimentierfeld – auch zum besseren Kennenlernen von sich selbst.
Es ist ein Widerspruch in sich, so analysiert der renommierte dänische Spielewissenschafter Jesper Juul in seinem Buch „The Art of Failure – An Essay on the Pain of Playing Video Games“ (MIT Press, 2013), dass wir uns Videospielen aussetzen, im klaren Wissen darüber, dass sie uns in unangenehme Emotionszustände versetzen werden. Keiner verliert gerne, und nur manchmal hat man auch in seinem Innersten gar kein Problem damit. Der Grund, warum wir uns doch darauf einlassen, so Juul, sei ähnlich wie bei der Konfrontation mit tragischen Inhalten in der Kunst, etwa bei Filmen oder Büchern. Wir seien gespalten: Die eine Hälfte in uns denkt kurzfristig und will unangenehme Dinge und Empfindungen um jeden Preis vermeiden, die andere sieht das Gesamtbild, die ästhetischen Werte eines (interaktiven) Werkes und die positiven Implikationen und Lerneffekte, die daraus entstehen können. Wir wissen auch: Spiele sind ein wunderbares Experimentierfeld – nicht nur zum Testen und Ausreizen von Systemen, der Erprobung von Aktion und Reaktion, sondern auch zum besseren Kennenlernen von sich selbst. Wie man beim Scheitern im Spiel reagiert und welche Relevanz man in Folge dessen bewusst oder unbewusst dem Spiel beimisst, zeigt, wie man mit den eigenen Unzulänglichkeiten umgeht.
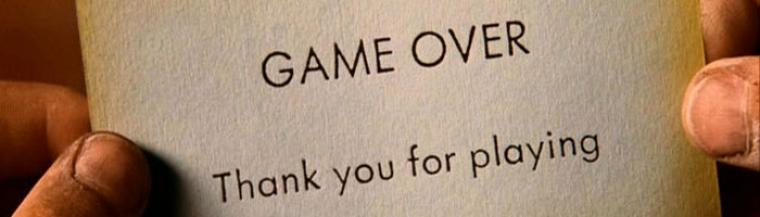
Spiele sind Selbstzweck, sie haben ihre eigenen Regelwelten, bei denen es erst mal keine Verbindungen oder Konsequenzen mit der Welt außerhalb des Spiels gibt. Die Schnittstelle, die ein Spiel mit dem Außerhalb verbindet, sind wir, die Spielenden. Es kommt auf die Umstände an – warum man ein Spiel spielt, wie man es spielt und in welchem Kontext –, die darüber entscheiden, ob das (unausweichliche) Scheitern im Spiel emotionale Gleichgültigkeit hervorruft oder aber ein kleines Ärgernis oder einen persönlichen Skandal darstellt. Jesper Juul nennt das „emotional gamble“ . Je wichtiger wir das Spiel nehmen, je höher der persönliche Aufwand ausfällt und je stärker der Wunsch ist, zu gewinnen, desto drastischer werden die negativen Emotionen in der Regel ausfallen, wenn wir mit dem Scheitern im Spiel konfrontiert werden.
Je wichtiger wir das Spiel nehmen, desto drastischer die negativen Emotionen beim Scheitern.
Es gilt daher, die jeweiligen psychischen Parameter so abzuändern, dass Niederlagen für einen selbst erträglicher werden und gesellschaftlich allzu unpassende negative Reaktionen (Beschimpfen der Mitspieler, Einschlagen auf Spielgeräte, usw.) ausbleiben oder anderswertig kompensiert werden. Beim Kompensieren ist vor allem Ablenkung von sich selbst gefragt, denn je mehr man die Schuld fürs Scheitern von sich auf andere Menschen, Dinge oder Umstände schiebt, desto einfacher fällt es, die Bloßstellung der eigenen Unzulänglichkeiten zu verarbeiten. Die Ausreden und Zuweisungen reichen dabei von moderatem Fatalismus („Heute ist eben nicht mein Tag“) über eine Fehlersuche im System („Das Spiel ist unfair“, „Der Joystick hat nicht richtig reagiert“) bis zur dreisten Herabwürdigung der besseren Leistung der Kontrahenten („Du hattest bloß Glück“, „Du spielst das Spiel ja viel öfter als ich“).

Es ist ja nur ein Spiel!“ ist ein Spruch, der gerne wahlweise als belehrende Floskel von Nicht-Spielenden oder als höhnische Bemerkung von Gewinnerinnen und Gewinnern gegenüber den Verliererinnen und Verlierern benutzt wird, um zu signalisieren, dass es keinen Grund für eine allzu intensive emotionale Auseinandersetzung mit und in Spielen gäbe. Sie und unsere dazugehörige Leistung hätten ja keine substanzielle Relevanz außerhalb der Spielwelt. Tatsächlich wissen aber zumindest die Gewinnenden genau über das Wesen von Sieg und Niederlage im Spiel Bescheid. Ein Spiel kann seine Inhalte und sein Regelwerk erst entfalten, wenn wir uns in einer gewissen Ernsthaftigkeit darauf einlassen. Mehr als bei anderen Kunst- und Kulturformen wie Theater oder Film ermöglicht beim digitalen Spiel die Interaktivität eine stärkere Identifikation mit den Inhalten.
Ein Spiel kann sich erst entfalten, wenn wir uns in einer gewissen Ernsthaftigkeit darauf einlassen.
Das passiert nicht nur auf narrativer Ebene, sondern auch durch eine Zusammenführung des jeweiligen Spielsystems mit der Leistung, die die oder der Spielende dazu einbringt. Diese Form der Involviertheit ist eine einzigartige Stärke von Spielen. Sie nicht ernstzunehmen bzw. dem Spiel während des Spielens keine Relevanz beizumessen, würde das Wesen von Spielen ad absurdum führen und ihnen ihren Sinn nehmen. „You can't just take, you have to give“, rät Pac-Man- und Donkey Kong-Profi Billy Mitchell in der Videospiel-Comedy-Serie „Pure Pwnage“ dem frustrierten Protagonisten Jeremy, als der sich der Relevanz des Scheiterns gerade verweigert, indem er lustlos an einem Arcade-Automaten spielt, ohne Leistung erbringen zu wollen. Der große Vorteil beim Spielen ist, dass wir zu jeder Zeit aus dem Spiel heraustreten, das Game beenden und die Anwendung schließen können. Insofern ist ein Spiel tatsächlich „nur ein Spiel“ – allerdings nur dann, wenn es gerade nicht gespielt wird und die Freude oder der Ärger über seinen vorigen Ausgang wieder verebbt ist.

Nur wer die Angst vor dem eigenen Scheitern im Spiel verliert und die unmittelbaren, negativen Emotionen im Griff hat, ist imstande, ein Spiel frei zu genießen und früher oder später bemerkenswerte Leistungen darin zu erbringen. Aktuelle Computer- und Videospiele nehmen uns diese Angst, indem sie – ähnlich wie bei Gewaltdarstellungen ohne das Zeigen von Leid und Schmerz – unser Scheitern nicht bewerten, sondern uns sofort wieder neu probieren lassen.
Egal, ob dutzendfache Bildschirmtode bei Super Meat Boy, wo unsere Figur nach jeder kleinen Niederlage in Sekundenschnelle wieder reaktiviert wird, oder ein neues Match nach einer Niederlage in StarCraft II, das nur zwei Klicks entfernt ist: Das Experimentierfeld Computerspiel lässt uns heute mehr Freiraum zum Ausprobieren unterschiedlicher Methoden, um größere Herausforderungen zu meistern, als in Zeiten, wo man nach dem Verlust aller Bildschirmleben wieder ganz von vorne beginnen oder lange, zähe Ladezeiten in Kauf nehmen musste.

Apropos StarCraft II: Der Spielekommentator Mike „HuskyStarCraft“ Lamond zieht seit Anfang März 2013 dem Scheitern beim Spielen auf seine Weise die Zähne. In seiner Videoserie „Bronze League Heroes“ macht er sich liebevoll über Matches schlechterer Spielerinnen und Spieler lustig und bestärkt die Zusehenden dabei gleichzeitig, sich die eigene Scheu vor dem Scheitern zu nehmen. Es wäre doch schade, sich damit den Spaß am Spiel, der Herausforderung und vielleicht sogar an den eigenen Unzulänglichkeiten zu nehmen.
Es ist ein bisschen so, wie es der kuriose Spieleprofi Billy Mitchell in seiner kleinen Brandrede in „Pure Pwnage“ weiter ausführt: „Winning is everything, but losing isn't.“
Dieser Text erschien ursprünglich für WASD #3
