Der hohe Preis von F2P
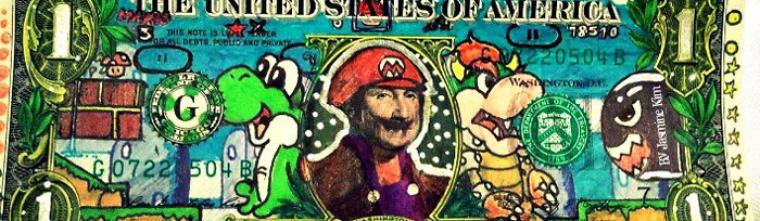
Der folgende Text erschien ursprünglich für den GameStandard - man beachte auch die umfangreiche Diskussion ebendort.
Die Gamesbranche hat einen Startvorteil: Während sich der Rest der Unterhaltungsindustrien, von der Musik- über die Filmindustrie bis hin zum Verlagswesen, erst seit dem Aufkommen von Internet, Kompressionsmethoden und elektronischen Lesegeräten um das Überleben seines zuvor analogen Geschäftsmodells in der digitalen Welt den Kopf zerbrechen muss, handelt die Gamesindustrie seit ihren Anfängen mit digitalen Waren, bei denen die Verbreitung durch einfache Kopie quasi Bestandteil des Produkts ist. Schon lange vor Tauschbörsen und DRM wurden Floppydisks oder gar Datassetten auf den Schulhöfen oder per schlichtem Postversand verbreitet, und so ist die Geschichte der Gamesindustrie zugleich die Geschichte eines konstanten, langen und letztlich aussichtslosen Kampfes gegen die "Raubkopie".
Die Gamesbranche hat diesen Startvorteil allerdings nur wenig genutzt: Während die Musikindustrie nach verzweifelten Versuchen, ihre Kunden zuerst durch Klagen und später durch technische Maßnahmen vom Kopieren abzuhalten, inzwischen großteils auf DRM verzichtet, werden drakonische Kopierschutzmaßnahmen im Games-Bereich, etwa Ubisofts "Always online"-DRM, nur zögerlich und nach teils jahrelangen Spielerprotesten zurückgenommen. Im Gegenteil: Populäre Plattformen wie Steam nehmen sich Rechte gegenüber ihren Käufern heraus, die an Sittenwidrigkeit grenzen, und Blockbuster wie "Diablo 3" opfern gar ganze Spielelemente wie etwa einen Offline-Singleplayermodus nur notdürftig verschleiert auf dem Altar der Verkaufsmaximierung.

Dass die Musikindustrie ihren noch vor wenigen Jahren aussichtslos erscheinenden Todesmarsch mit einer kleinen Trendwende beenden konnte, hat sicher auch mit dem Drehen an einer einfachen Schraube zu tun: Seit auf Downloadportalen wie Apples iTunes Musik zu einem deutlich reduzierten Preis DRM-frei gekauft werden kann, steigt die Bereitschaft der Kunden, wieder Geld für Musik in die Hand zu nehmen. Stimmt der Preis, stimmt der Absatz - trotz Gratisangeboten im Netz.
Sind Spiele vielleicht schlicht "zu teuer"?
Nun tut sich die Gamesbranche seit Jahren schwer, ihre Preispolitik zu modernisieren. Trotz rückläufiger Spieldauer pendelt der Preis für ein Spiel seit Jahren bei der psychologisch hohen Grenze von 50 Euro bei PC und 60 Euro bei Konsolen. Auch wenn zugleich Experimente wieHumble Indie Bundles oder der Erfolg von zeitlich begrenzten Abverkäufen wie Steam Sales eigentlich eine deutliche Sprache sprechen: Als Valve nur wenige Wochen nach Release von "Left4Dead" im Herbst 2009 ein Wochenende lang den Preis des Spiels um die Hälfte senkte, erhöhte sich der Verkauf um satte 3000 Prozent. Da stellt sich eigentlich eine Frage: Sind Spiele vielleicht schlicht "zu teuer"?

Die mögliche Erkenntnis, dass die Senkung der regulären Spielepreise zu unverhältnismäßig größeren Einnahmen und einem gleichzeitigen Rückgang des Problems "Raubkopieren" führen könnte, hat sich bei den Größen der Gamesbranche bisher nicht durchgesetzt. Stattdessen setzt man zunehmend auf einen radikal anderen Zugang: Free2Play, so der Schwenk vieler großer Publisher, gehört die Zukunft.
Und wieder ist es die böse "Raubkopie", die offiziell diesen Paradigmenwechsel einläutet: Wegen angeblicher 95 % Piraterierate sei F2P für die Publisher letztlich lukrativer, so prophezeite Ubisoft-Boss Yves Guillemot in einem Interview - eine Aussage, die für viele Beobachter schon allein aufgrund der schlicht nicht seriös erhebbaren realen Zahlen einen seltsamen Beigeschmack hat.

Ist das also die rosige Games-Zukunft? Die Spiele gratis, keine Fehlkäufe mehr, konstanter Support und Nachschub für Spieler, sorgloses Ausprobieren, das auch Gelegenheitsspielern entgegenkommt - die Liste der Vorteile von F2P ist nicht unbeeindruckend. Was auf den ersten Blick wie eine gute Botschaft für Spieler klingt, ist aber möglicherweise eine gefährliche Drohung. Denn Geld, so viel war auch ohne Guillemots Aussagen klar, wollen die Entwickler natürlich trotzdem verdienen - am besten mehr als mit Vollpreistiteln. Statt die psychologische Hürde des Vollpreises vor Spielbeginn zu setzen, sollen Freemium-Angebote oder In-Game-Verkäufe gegen echtes Geld die Kassen klingeln lassen. Das Modell soll ambitioniert in alle Genres erweitert werden: "Warframe", "Siedler Online", "Mechwarrior Online", "Might and Magic: Heroes Online" und unzählige andere Titel auch aus traditionellen Vollpreisnischen setzen mittelfristig auf F2P.
Zugegeben: F2P hat sich in einigen Nischen hervorragend bewährt. Online-Spiele wie "League of Legends" oder "World of Tanks" schaffen die profitable Balance zwischen Gratisspaß und freiwilligem Bezahlen bereits jetzt, während vor allem in der Welt der MMOs zunehmend Abomodelle zugunsten von F2P verschwinden, wie bei der Umstellungvon "Star Wars: The Old Republic" auf F2P oder als Mischformen wie "Guild Wars 2" reüssieren.

Die größte - und zugleich am meisten zur Sorge Anlass gebende - F2P-Erfolgsgeschichte findet sich aber im Casual-Bereich: In Gratisspielen wie "Farmville" oder "Tiny Tower" haben Spieler die Option, ohne Bezahlung zu spielen, gegen echtes Geld aber können Abkürzungen genommen werden - und die wichtigste Aufgabe des Spieldesigns ist es, den Spielern dies schmackhaft zu machen. Erfolgreiche F2P-Titel wie "Farmville", "Sims Social" oder eben auch "Tiny Tower" werden, wie ein vielbeachteter Text des Journalisten Tim Rogers bereits letztes Jahr anschaulich demonstrierte, von hochspezialisierten Teams aus Psychologen und Mathematikern schließlich zu genau einem Zweck entworfen: Monetisierung.
Frustration ist essenziell, denn nur sie bringt den Spieler zum Bezahlen
Der Weg dorthin führt über mehrere verhaltenspsychologische Stadien, beginnend beim "leichten Einstieg", über die anfangs kontinuierliche Belohnung und darauf einsetzende Suchtspirale bis hin - und darin unterscheiden sich F2P-Titel schlussendlich alle grundlegend von regulären Spielen - zur absichtlichen Frustration seiner früher oder später immer mehr in der Spielwelt engagierten Spieler. Diese absichtliche Frustration ist essenziell, denn nur sie bringt den Spieler dazu, die Brieftasche zu zücken.
Besonders vielsagend ist hier der Begriff des "fun pain" als Monetisierungsstrategie: Das F2P-Spiel SOLL seine Spieler gerade so weit langweilen und frustrieren, dass sie bereit sind, Geld zu bezahlen - das bedeutet nicht "Pay2Win", ein weitgehend verpöntes Geschäftsmodell, das Spielern nur gegen Geld spielentscheidende Vorteile verschafft, aber bedingt allein durch seine Struktur ein anderes Spieldesign: Ein Spiel, das mit F2P-Modell Geld verdienen will, muss seine Spieler naturgemäß manipulieren - sonst bezahlen sie schließlich nicht.

Das traditionelle Geschäftsmodell verlangt relativ viel Geld für ein Vollpreisspiel, das in der Folge als Qualitätskriterium hat, möglichst viel Spaß zu machen, um die Anfangsinvestition zu rechtfertigen. Free2Play als Geschäftsmodell hingegen stellt neben die Grundprämisse Spaß - sonst spielt schließlich niemand - als ebenso wichtiges, gleichberechtigtes Element die Manipulation des Spielers, um ihn zum Zücken der Brieftasche zu bewegen. Es ist ein schmaler Grat, der hier beschritten werden soll. Es bleibt zu hoffen, dass die Balance zwischen Qualität und Manipulation so bewältigt wird, dass die Spieler sich nicht gegängelt fühlen, sondern freiwillig Geld in einen Titel investieren, der ihnen dann dank echtem Mehrwert noch mehr Spaß macht.
Zu hoffen ist aber noch etwas anderes: Dass die Spielebranche, wie vor ihr die Musikindustrie, endlich jenen Komfortpreisbereich findet, der ganz ohne psychologische Tricks und Manipulation auch frühere "Raubkopierer" selbstverständlich zu Kunden werden lässt.
Free2Play wird seine Kunden finden. Die alleinige Zukunft des Spielens dürfte es, auch angesichts der Fülle alternativer Erfolgsmodelle wie etwa Pay-what-you want, Kickstarter oder episodenhaften Spielen wie "The Walking Dead", aber wohl eher doch nicht werden - zum Glück.
